Wer gerne mal in die Unterwelt eintaucht, natürlich nur literarisch, für den kann das Übersetzen von Thrillern eine bereichernde Abwechslung sein. Thriller zu lesen ist an sich schon spannend, sie zu übersetzen, noch viel mehr! Das Genre ist kulturell tief verwurzelt und beim Übersetzen hat man es beispielsweise mit einer ganz eigenen Terminologie zu tun. Neben der zum Teil sehr spezifischen Sprache, erfordert das Übersetzen von Thrillern – egal ob es sich um einen Noir-Thriller oder um einen heiteren Krimi dreht – ein breites Wissen über das Rechts- und Polizeisystem des jeweiligen Landes sowie über sämtliche Institutionen, die sich mit Verbrechen jedweder Art auseinandersetzen. Das Spektrum der Dialoge reicht von der hoch formellen Sprache der Richter und Anwälte bis hin zum regionalen Street Slang von der derbsten Sorte. Was sollte man also während des Übersetzungsprozesses eines Thrillers beachten? Wie bringt man den Mörder wortgewandt hinter Gitter?
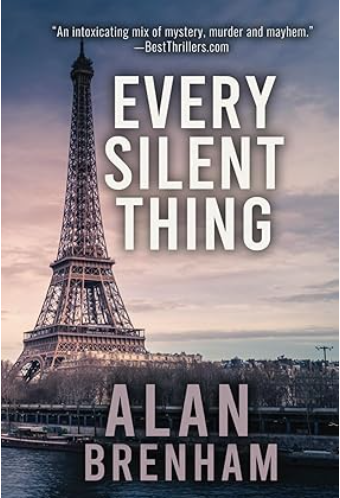
ISBN-13 : 979-8864646649
Genug Zeit einplanen
Es kommt natürlich darauf an, ob man sich den ganzen Tag an die Übersetzung setzen kann oder nicht. Ich mache das nebenher, deshalb stehen bei mir auch jeden Tag noch andere Deadlines an. Das sollte man vorher gegenüber dem Verlagshaus oder der jeweils anderen Vertragsseite auch deutlich kommunizieren und sich das vertraglich bestätigen lassen, denn bei 80.000 und mehr Wörtern oder guten 300 Seiten aufwärts kann so eine Übersetzung, wenn man nicht den ganzen Tag dransitzt, schon mal neun bis zwölf Monate dauern. Wer selbst den Vertrag selbst aufsetzt, für den bietet sich, je nachdem auf welcher Seite des Atlantiks man sitzt, entweder der Normvertrag des VdÜ (https://literaturuebersetzer.de/berufspraktisches/rechtliches/normvertrag/) oder der Normvertrag von PEN America (https://pen.org/a-model-contract-for-literary-translations/) an. Beide Normverträge lassen sich nach Belieben modifizieren.
Erst einmal gründlich lesen und dann nochmals und nochmals
Also, bevor ich mich an die Übersetzung eines Thrillers oder generell an die Übersetzung eines längeren Buchtextes mache, lese ich den Text erst einmal komplett durch. Das kann sich bei Texten, die gut 300 Seiten haben können, etwas ziehen. Da kommt mir entgegen, dass ich mich zu den Schnelllesern zählen kann. Der Übersetzer sitzt näher am Text dran, als der Autor selbst. Da man in der Regel zwei bis dreimal, Satz für Satz, das ganze Buch durchgeht, fallen einem manchmal sogar Fehler im Handlungsverlauf auf. Das Manuskript kommt meist als Word-Dokument. Oft bitte ich aber den Verlag oder die Autoren um ein zusätzliches Druckexemplar und wenn ich Glück habe, dann bekomme ich sogar ein signiertes. Das erspart mir Druckkosten und zudem macht sich das Buch später schön im Regal. Den Text am Anfang einmal komplett gelesen zu haben hat den Vorteil, dass man einen Gesamteindruck vom Buch bekommt, mit dem Text und der Stimme des Autors vertraut wird und ein Gefühl für den individuellen Schreibstil des Autors bekommt.
Kapitel für Kapitel
Jetzt gilt es Teilziele zu erreichen. Dazu unterteile ich mir den Text in Abschnitte von ein bis drei Kapiteln. Das ursprüngliche Word-Dokument wird in mehrere Word-Dokumente unterteilt. Gerade sitze ich beispielsweise an der Übersetzung von Alan Brenhams „Every Silent Thing“ und das hat mal gute vierzig Kapitel. Und ja, ich arbeite mit CAT-Tools und zwar mit Trados. Das hat den Vorteil, dass man große Textmengen hochladen und auf die eigene Termbase zugreifen kann. Allerdings habe ich immer den Originaltext neben mir liegen, um den Text in seiner Struktur, visuell erfassen zu können. Dann wird übersetzt. Kapitel für Kapitel. Eine Art Stapelverarbeitung also. Durch diese Arbeitsweise können die fertigen Kapitel schon mal zum Editieren und Gegenlesen zur nächsten Stelle gehen.

Abb.: Das Thriller-Genre ist weites Feld
Quelle: https://windsorgirls.weebly.com/gemini-productions/sub-genres-of-thrillers
Termbase und ein gutes altes Wörterbuch
Wie bereits gesagt, ist das Vokabular in Thrillern – und das gilt für jedes andere Genre ebenfalls – sehr spezifisch. Slang unterscheidet sich zum Teil sehr stark regional. Beispielsweise ist der Slang in New York nicht mit dem aus New Jersey vergleichbar. Mir erging das so mit Steve Bassetts Payback, dessen Handlung in New Jersey spielt. Der Slang war regional so spezifisch, dass viele Wörter in keinem Wörterbuch – ob online oder nicht – zu finden waren. Zum Glück handelte es sich um einen noch lebenden Autor und so konnte ich die eine oder andere Frage direkt stellen. Jedoch hat man nur selten das Glück, direkt mit dem Autor kommunizieren zu können. Aus diesem Grunde habe ich mir über die Jahre eine eigene Termbase zum Thema Triller angelegt, die mittlerweile einige hundert spezifische Ausdrücke umfasst. Um sich mit Dialogen vertraut zu machen, hilft es, bereits übersetzte Bücher zu lesen und auch aktuelle Thriller im Fernsehen (den Tatort über die Mediathek auf ard.de oder andere Krimis auf zdf.de) anzuschauen. So bekommt man mit, wie Ermittler, Täter und/oder die Unterwelt miteinander reden. Ebenfalls hilft es enorm, mit den aktuellen forensischen Verfahren und Ermittlungstechniken vertraut zu werden.
Foreignization, Domestication & mehr
Während des Übersetzungsprozesses stößt man auf weitere Entscheidungen, die zu treffen sind. Hier möchte ich noch kurz auf einen Aspekt eingehen. Generell muss man sich entscheiden, ob man den Text sprachlich mehr im Land des Ausgangstextes lassen möchte (foreignization) oder mehr an das Land der Zielsprache anpasst (domestication). Ich tendiere generell zu ersterem mit der Folge, dass ich z.B. oft Rangbezeichnungen der Polizei und beim Gericht beibehalte, Straßennamen nicht verändere und vieles mehr. Das gibt dem Leser das Gefühl, sich während des Lesens wirklich, wie bei Payback, in New Jersey zu befinden. Es bleibt jedoch nicht aus, dass man im weiteren Übersetzungsprozess, zuvor getroffene Entscheidungen, später nochmals revidieren muss. Aber das gehört dazu. Man sitzt beim Übersetzen so nah auf dem Text, dass man so manches anders sieht, wenn man den Text ein paar Tage liegen lässt und ihn dann nochmals überarbeitet.
Die Literaturübersetzung lässt dem Übersetzer generell viele Freiheiten. Das macht sie so interessant, erfordert aber auch den Mut, Entscheidungen zu treffen, da man oft nicht die Möglichkeit hat, beim Autor oder Verlag nachzufragen. Da ist es wichtig, sich selbst zu vertrauen und sich auf die eigene ,Stimmeʻ zu verlassen.

Petra Caroline Rieker is an accomplished freelance journalist and published translator of six works of fiction and translation reference. Specializing in English > German, she is the owner of The Art of German Language, a translation and tutoring practice, and publisher of a blog which explores the nuance of translating creative works (www.TheArtofGermanLanguage.com/petras-blog). She served four years on the Board of Directors for the DVTA, a chapter of ATA. She holds a Major in Business Administration from the Otto-Friedrich University in Bamberg, Germany and is a certified Public Relations Consultant (DAPR) and is currently enrolled in the Master Program for literary studies at the University in Hagen, Germany.
